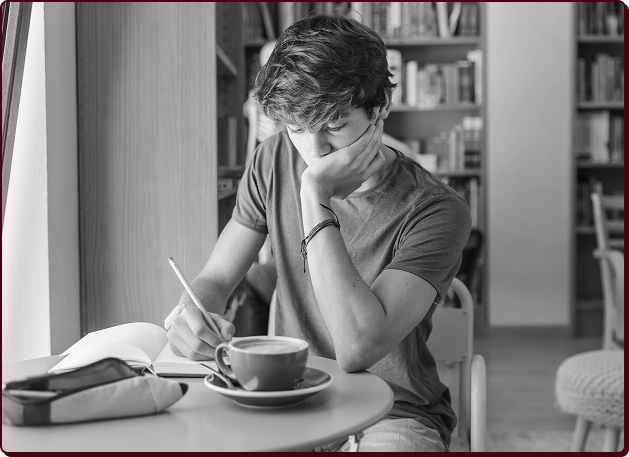
Das Tourette-Syndrom ist mehr als nur „komisches Zucken“ oder ungewollte Geräusche. Es ist eine komplexe neurologische Besonderheit, die sich ganz unterschiedlich zeigen kann und über die es noch viele Missverständnisse gibt. Hier erfährst du, was wirklich dahintersteckt, wer betroffen ist und wie man gut damit leben kann.
.png)
.png)
Jungen haben häufiger Tourette als Mädchen
.png)
2 in 15 Grundschülern erleben Tics
.png)
1 in 100 Erwachsenen lebt mit dem Tourette Syndrom
Statistiken machen sichtbar, was oft übersehen wird: Neurodivergenz ist kein Randthema. Hier findest du Daten, die zeigen, wie verbreitet und vielfältig neurodiverse Profile sind.
1%
der Weltbevölkerung hat das Tourette Syndrom
10-15%
aller Grundschüler erleben min. einmal Tics
3 bis 4,5 zu 1
Jungen haben häufiger Tourette als Mädchen
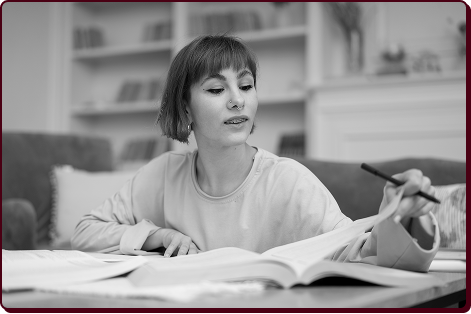
Das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, genauer gesagt eine chronische Tic-Störung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sowohl mehrere motorische Tics (also Bewegungen) als auch mindestens ein vokaler Tic (also Geräusche oder Laute) auftreten. Diese Tics beginnen in der Kindheit – meist vor dem 18. Lebensjahr – und bestehen mindestens über ein Jahr hinweg. Ein Tic ist eine plötzlich einsetzende, sich wiederholende, meist nicht rhythmische Bewegung oder Lautäußerung, die sich kaum kontrollieren lässt. Auch wenn sie auf Außenstehende manchmal wie eine absichtliche Handlung wirken, sind sie unwillkürlich. Die Erkrankung ist schon lange bekannt: Bereits im Jahr 1827 wurde sie erstmals in der medizinischen Literatur beschrieben.
.png)
.png)
Tics beginnen typischerweise im Grundschulalter; meist zwischen dem 6. und 8. Lebensjahr. In selteneren Fällen können sie auch schon vor dem vierten Lebensjahr auftreten. Bei über 93 % der Betroffenen zeigen sich die ersten Anzeichen vor dem elften Lebensjahr, bei 99 % vor dem fünfzehnten. Die Symptome verändern sich oft im Verlauf der Kindheit und Jugend und können in ihrer Ausprägung schwanken.
Das Tourette-Syndrom ist auch unter anderen Namen bekannt. In medizinischen Fachtexten wird häufig vom „Gilles-de-la-Tourette-Syndrom“ gesprochen, benannt nach dem französischen Arzt Georges Gilles de la Tourette, der die Erkrankung im Jahr 1885 erstmals ausführlich beschrieb. Oft wird auch die kürzere Bezeichnung „Tourette-Syndrom“ verwendet. Im englischen Sprachraum und in einigen Fachkreisen ist zudem die Abkürzung „TS“ gebräuchlich.
Viele Menschen mit Tourette-Syndrom haben zusätzlich mit weiteren psychischen oder neurologischen Herausforderungen zu tun. Dazu gehören unter anderem ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und Zwangsstörungen (OCD). Auch Störungen des Sozialverhaltens, oppositionelles Verhalten, Lernstörungen, Angststörungen, Depressionen, Schlafprobleme oder selbstverletzendes Verhalten können als Begleiterkrankungen auftreten. Diese zusätzlichen Belastungen beeinflussen sden Alltag oft stärker als die Tics selbst.
Das Tourette-Syndrom äußert sich durch verschiedene Tics – das sind unwillkürliche, plötzliche Bewegungen oder Lautäußerungen. Wie genau sich diese Tics zeigen, ist von Person zu Person verschieden. Manche Tics sind kaum auffällig, andere können für die Betroffenen oder das Umfeld belastend sein. Oft kommen mehrere Tics gleichzeitig vor, und sie verändern sich im Laufe der Zeit. Wichtig zu wissen: Tics sind nicht „absichtlich“ und lassen sich meist nur kurzfristig unterdrücken – was jedoch zu einem inneren Spannungsaufbau führen kann.


Die Diagnose wird gestellt, wenn motorische und vokale Tics über mindestens ein Jahr hinweg auftreten – und sich vor dem 18. Lebensjahr entwickelt haben. Wichtig ist, dass die Tics unwillkürlich, schnell und nicht rhythmisch sind. Die Diagnose erfolgt durch erfahrene Fachärztinnen oder Fachärzte, meist aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Neurologie. Es werden genaue Beobachtungen, Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen sowie manchmal Videoanalysen genutzt, um die Tics zu dokumentieren und andere Ursachen auszuschließen.
.png)